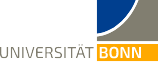Schmerzen bei Durchblutungserkrankungen
Schmerzen durch Durchblutungsstörungen entstehen, wenn die Blutversorgung eines Körperteils eingeschränkt ist und die betroffenen Gewebe nicht genügend Sauerstoff und Nährstoffe erhalten. Diese Art von Schmerzen tritt häufig in den Beinen auf, kann aber auch andere Körperteile betreffen.
Zu den häufigsten Formen zählen die periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK), die zu Schmerzen vor allem in den Beinen führt, sowie Durchblutungsstörungen infolge der Gefäßkrämpfe (Vasospasmen) wie bei Raynaud’s Phänomen, welche beim Versagen der konservativen Therapiemaßnahmen mit Neuromodulationsverfahren erfolgreich zu behandelnd sind.
Ursachen von Durchblutungsstörungen
Die häufigsten Ursachen für Durchblutungsstörungen sind:
- Atherosklerose: Die häufigste Ursache für Durchblutungsstörungen. Fettablagerungen (Plaques) an den Wänden der Arterien verengen oder blockieren die Blutgefäße.
- Rauchen: Nikotin verengt die Blutgefäße und schädigt die Arterien, was das Risiko von Durchblutungsstörungen erhöht.
- Diabetes: Diabetes kann zu einer Gefäßschädigung führen und die Wahrscheinlichkeit für Durchblutungsprobleme erhöhen.
- Bluthochdruck: Hoher Blutdruck belastet die Blutgefäße und fördert die Entwicklung von Atherosklerose.
- Erhöhte Cholesterinwerte: Hohe Cholesterinwerte können Ablagerungen in den Arterien fördern und so die Blutzirkulation einschränken.
- Genetische Faktoren: Einige Menschen haben eine genetische Prädisposition für Gefäßprobleme.
- Bewegungsmangel und Übergewicht: Diese Faktoren fördern die Atherosklerose und verschlechtern die Blutzirkulation.
Symptome von Durchblutungsstörungen
Die Symptome hängen davon ab, welches Gebiet des Körpers betroffen ist, und können in ihrer Intensität variieren:
- Schmerzen in den Beinen (bei pAVK): Diese Schmerzen treten oft beim Gehen oder Treppensteigen auf (Claudicatio intermittens) und bessern sich meist nach kurzer Ruhepause.
- Kälte und Taubheit: Betroffene Körperteile fühlen sich oft kalt oder taub an, vor allem Hände und Füße.
- Blasse oder bläuliche Haut: Durch eine eingeschränkte Blutzufuhr kann sich die Hautfarbe ändern.
- Schwächegefühl und Krämpfe: Besonders in den Beinen sind Krämpfe und Schwächezeichen häufig.
- Schlechtere Wundheilung: Die eingeschränkte Durchblutung führt dazu, dass Wunden langsamer heilen und sich häufiger Infektionen bilden.
Arten von Schmerzen bei Durchblutungsstörungen
- Belastungsschmerzen: Treten auf, wenn die Muskeln bei Aktivität mehr Sauerstoff benötigen und durch die Engstellen in den Arterien nicht ausreichend versorgt werden können. Diese Schmerzen bessern sich oft in Ruhe (Claudicatio intermittens).
- Ruhe-Schmerzen: In schweren Fällen kann auch im Ruhezustand ein konstanter, brennender Schmerz bestehen, der auf eine kritische Minderdurchblutung hinweist. Besonders nachts können diese Schmerzen auftreten, wenn die Beine flach aufliegen.
- Brennende oder kribbelnde Schmerzen: Oft typisch für periphere Nervenschäden durch Minderdurchblutung, besonders bei Diabetikern.
Die periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) ist eine Erkrankung, bei der die Arterien, die die Beine und andere periphere Körperteile mit Blut versorgen, durch Ablagerungen von Fett, Cholesterin und anderen Substanzen (Atherosklerose) verengt oder blockiert werden. Diese Verengung führt zu einer verminderten Blutzufuhr in den betroffenen Bereichen, was Schmerzen und andere Symptome verursacht, besonders bei körperlicher Belastung.
Symptome der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit
Die Symptome der pAVK können je nach Schweregrad der Erkrankung variieren. Zu den häufigsten gehören:
- Schmerzen beim Gehen (Claudicatio intermittens): Dies ist das charakteristische Symptom der pAVK. Es handelt sich um Schmerzen in den Waden, Oberschenkeln oder Hüften, die beim Gehen auftreten, insbesondere bei körperlicher Belastung. Die Schmerzen bessern sich in Ruhe.
- Kältegefühl und Taubheit in den Beinen: Aufgrund der unzureichenden Blutzufuhr können die betroffenen Beine sich kalt oder taub anfühlen.
- Blasse, glänzende Haut: Die Haut kann aufgrund der schlechten Blutzirkulation blass oder glänzend erscheinen.
- Schlechte Wundheilung: Wunden an den Füßen, Beinen oder Zehen können langsamer heilen oder sich infizieren.
- Gangrän (Gewebeabsterben): In schweren Fällen kann es aufgrund der unzureichenden Blutzufuhr zu Gewebeabsterben kommen. Dies betrifft meist die Zehen und Füße und kann zu Nekrosen führen, die eine Amputation erforderlich machen können.
- Schwache oder nicht tastbare Pulse: Bei pAVK sind die Arterien oft so stark verengt, dass die Pulse in den Füßen und Beinen nicht mehr spürbar sind.
Das Raynaud-Phänomen ist eine Erkrankung, bei der es zu einem vorübergehenden Verlust der Blutzirkulation in den Fingern und/oder Zehen kommt, oft ausgelöst durch Kälte oder Stress. Es handelt sich um eine sogenannte Vasospasmus-Störung, bei der sich die Blutgefäße in den betroffenen Bereichen plötzlich verengen, wodurch die Blutzufuhr gestört wird. Dies führt zu einer charakteristischen Farbveränderung der Haut, meist von blass oder blau bis rot, sobald die Blutzirkulation wiederhergestellt wird.
Ursachen und Mechanismen
Das Raynaud-Phänomen kann in zwei Hauptformen unterteilt werden:
- Primäres Raynaud-Phänomen:
- Ursache: Es tritt ohne eine zugrunde liegende Erkrankung oder Verletzung auf. Primäres Raynaud ist die häufigere Form und ist in der Regel gutartig. Die genaue Ursache ist unbekannt, aber man nimmt an, dass es durch eine übermäßige Reaktion der Blutgefäße auf Kälte oder Stress verursacht wird.
- Verlauf: Es ist meist nicht mit anderen gesundheitlichen Problemen verbunden und hat eine gute Prognose. Frauen sind häufiger betroffen als Männer.
- Sekundäres Raynaud-Phänomen (auch Raynaud-Syndrom genannt):
- Ursache: Es tritt als Symptom im Rahmen einer anderen zugrunde liegenden Erkrankung auf, meist einer Autoimmunerkrankung oder einer Bindegewebserkrankung. Häufige Ursachen sind:
- Systemische Sklerose (Sclerodermie): Eine Autoimmunerkrankung, die zu einer Verdickung und Verhärtung der Haut führt.
- Lupus erythematodes: Eine Autoimmunerkrankung, die verschiedene Organe betrifft.
- Rheumatoide Arthritis: Eine entzündliche Erkrankung der Gelenke, die auch die Blutgefäße betreffen kann.
- Atherosklerose: Arterienverkalkung, die den Blutfluss beeinträchtigt.
- Vibrationseinwirkungen: Zum Beispiel bei Menschen, die regelmäßig mit vibrierenden Maschinen arbeiten (z. B. Bauarbeiter oder Gärtner).
- Verlauf: Das sekundäre Raynaud-Phänomen ist oft schwerer und kann zu bleibenden Schäden an den betroffenen Gefäßen führen.
- Ursache: Es tritt als Symptom im Rahmen einer anderen zugrunde liegenden Erkrankung auf, meist einer Autoimmunerkrankung oder einer Bindegewebserkrankung. Häufige Ursachen sind:
Symptome des Raynaud-Phänomens
Die Symptome des Raynaud-Phänomens treten in typischen Anfällen auf, die durch bestimmte Auslöser (z. B. Kälte oder emotionaler Stress) ausgelöst werden können:
- Farbveränderungen der Haut: Die betroffenen Stellen, meistens Finger oder Zehen, wechseln nacheinander in verschiedenen Farben:
- Blass oder weiß: Die Blutgefäße verengen sich, und die Blutzufuhr wird reduziert, wodurch die Haut blass wird.
- Blau oder violett: Durch die reduzierte Blutzufuhr gelangt weniger Sauerstoff in das Gewebe, wodurch die Haut blau wird.
- Rötung: Nachdem sich die Blutgefäße wieder erweitern und der Blutfluss zurückkehrt, kann sich die Haut rot färben.
- Kältegefühl und Taubheit: Betroffene Körperteile fühlen sich kalt an, oft begleitet von einem Taubheitsgefühl aufgrund der verminderten Blutzufuhr.
- Schmerzen: Während eines Anfalls kann es zu Schmerzen kommen, die mit der verminderten Durchblutung zusammenhängen. Diese Schmerzen klingen oft ab, wenn die Blutzufuhr wiederhergestellt wird.
- Dauer der Anfälle: Die Anfälle dauern in der Regel wenige Minuten bis maximal 20 Minuten und hören auf, wenn der Auslöser (z. B. Kälte oder Stress) beseitigt wird und die Blutzirkulation wieder normalisiert ist.
Diagnose
Die Diagnose des Raynaud-Phänomens basiert hauptsächlich auf der klinischen Untersuchung und der Erhebung der Anamnese:
- Anamnese: Der Arzt fragt nach den Symptomen, deren Häufigkeit und Auslösern (Kälte, Stress) sowie nach anderen Erkrankungen, die mit Raynaud in Zusammenhang stehen könnten (z. B. Autoimmunerkrankungen).
- Farbwechsel der Haut beobachten: Der Arzt untersucht die Hautfarbe an den Extremitäten während eines Anfalls und nach dessen Beendigung, um das typische Muster zu erkennen.
- Doppler-Ultraschall: Mit dieser Methode kann die Blutzirkulation überprüft werden, um zu sehen, ob es eine Verengung der Blutgefäße gibt.
- Bluttests: Bei Verdacht auf eine zugrunde liegende Autoimmunerkrankung (bei sekundärem Raynaud) können Bluttests durchgeführt werden, um Marker für Erkrankungen wie Lupus oder systemische Sklerose zu erkennen.
- Nagelfalzkapillarmikroskopie: Eine spezielle Untersuchung, bei der die kleinen Blutgefäße in der Nähe des Nagels betrachtet werden. Dies kann hilfreich sein, um sekundäres Raynaud im Zusammenhang mit Autoimmunerkrankungen zu diagnostizieren.